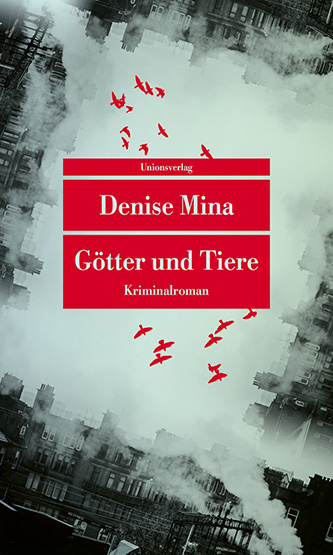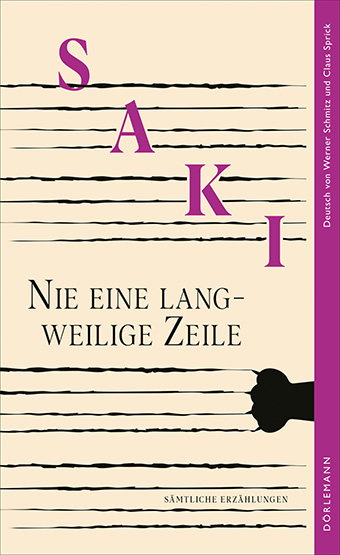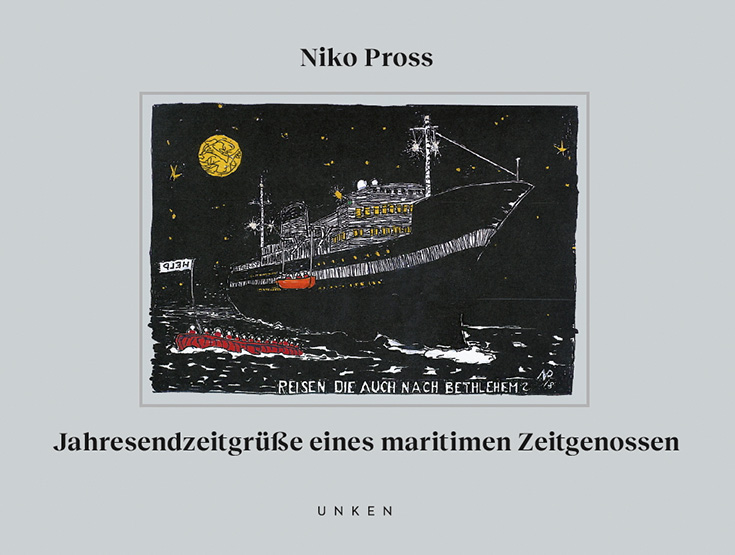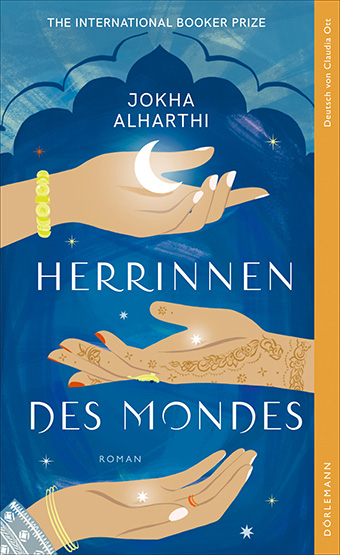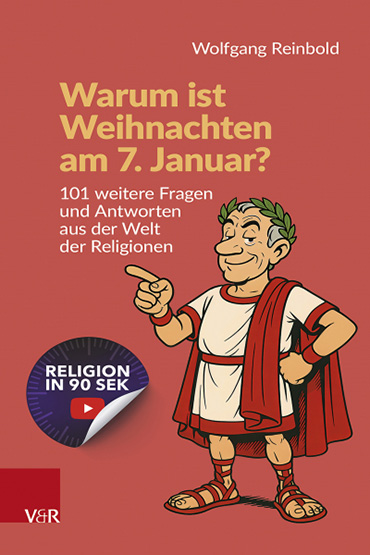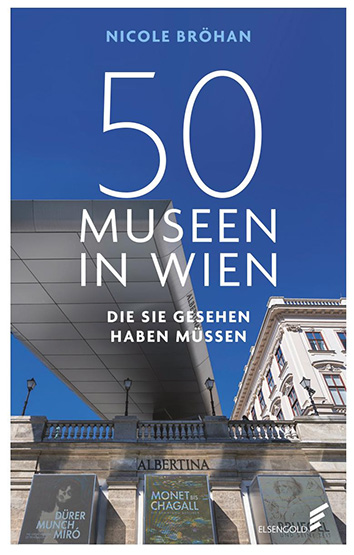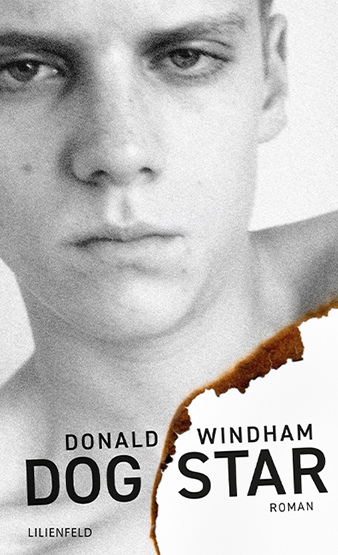Wenn jemand im strömenden Regen auf der Bordsteinkante sitzt, muss ihm etwas widerfahren sein, das ihn das Drumherum derart egal erscheinen und Anderen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Glasgow im Regen ist wahrlich kein Platz zum Ausruhen. Martin heißt der Mann, im Arm – genauer gesagt an seine Brust geklammert – ein kleiner Junge. Regungslos lassen ihn seine spärlichen Kräfte an Martin festhalten. Mehr Halt gibt es für ihn in diesem Moment nicht. Und Martin sinniert über das, was soeben passiert ist.
Ein Raubüberfall. In der Postfiliale. AK 47. Der Großvater des Jungen erhebt sich mit einem Mal und … steht nicht minder überraschend auf einmal auf der Seite … ja, auf welcher Seite eigentlich? Der, der AK 47? Des Räubers mit der weltbekannten Knarre? Es bekommt ihm nicht. Der Opa ist tot. Der kleine Junge sitzt wenig vor dem Regen beschützt auf dem Bordstein, klammert sich an Martin. So düster die Szenerie, so undurchsichtig das, was vor wenigen Minuten passiert ist.
Detective Sergeant Alex Morrow und ihr Partner Detective Constable Harris stehen vor einem Haufen voller Scherben, in denen so manches fehlgeleitete Licht Ecken Glasgows erleuchtet, die vor Düsternis nur so strotzen.
Denise Mina zeigt die dunkle Fratze Glasgows in ihrer perfidesten Form. Politiker, die sich an keinerlei Spielregeln halten. Gangster, die sich von Berufs wegen nicht an Regeln halten (können, wollen, sollen, dürfen). Und zwischendrin die Polizisten, die tagein, tagaus ihren Kopf hinhalten, damit das alles auch schön so bleibt.
DS Morrow und DC Harris kennen diese Spielchen. Sie kennen auch so manchen Hitzkopf und machen sich dessen Wissen zunutze. Genug, um voranzukommen, nicht zu viel, um sich abhängig zu machen. Es ist ein steter Kampf um Loyalität und Erfolg.
„Götter und Tiere“ reißt den Leser aus dem Anfangseinlesen mit expliziten Beschreibungen wie hart das Leben ist, kennt man keine Regeln. Denise Mina schafft trotzdem eine angenehme, fast schon wohlige Atmosphäre, in der man sich sicher fühlt. Mitgefühl und knallharte Faktenlage verwebt sie derart gekonnt, dass man gar nicht merkt wie tief man selbst im Dickicht der Fälle gefangen ist. So muss ein Krimi sein!